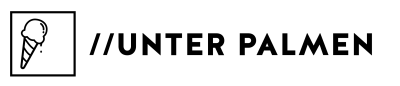Der Ausschluss vom städtischen Leben ist für viele Menschen bittere Realität. Wir haben uns mit dem Sozialwissenschaftler und Aktivisten Raphael Kiczka getroffen und ihn gefragt, wem die Stadt gehört.
– by Emil Lechaim & Helena Specht

»Helena: Wie werden Menschen vom Wohnen und Leben in Wien ausgeschlossen?
Raphael: Die Ausgrenzung von Menschen findet auf verschiedenen Ebenen statt. In Wien verspricht der soziale Wohnbau, allen voran zahlreiche Gemeindewohnungen, leistbares Wohnen. Der Anspruch auf diese Wohnungen wird jedoch durch bestimmte Hürden erschwert. Wer die nicht überwinden kann, hat Pech gehabt. Er oder sie muss sich auf dem privaten Wohnungsmarkt durchschlagen. Hier sind die Mieten grundsätzlich viel teurer und für gefragte Lagen gibt es nochmal extra Zuschläge.
Außerdem wird der öffentliche Raum immer mehr kommerzialisiert. Der Aufenthalt in vielen Bereichen ist nur gestattet, wenn man bereit und fähig ist, dort zu konsumieren. Das heißt, es gibt immer weniger öffentliche Orte, an denen man sich einfach treffen kann, ohne Geld ausgeben zu müssen.
Ein dritter Ausschlussmechanismus ist die Exklusivität der aktuellen Demokratie. In Wien darf ein Drittel der Bewohner_innen nicht an Wahlen teilnehmen. Diese Menschen werden weder im Gemeinderat noch im Parlament repräsentiert und ihre Interessen somit weniger wahrgenommen.
»Emil: Was ist deine Kritik an der aktuellen Stadtplanungspolitik? Wie trägt sie zu solchen Ausschlüssen bei?
Raphael: Die Stadt Wien wird von vielen Menschen immer als das Paradebeispiel für sozialen Wohnungsbau herangezogen. Das “Rote Wien” muss man zur Zeit aber mehr als Marketinginstrument verstehen, der Weg zu einer Gemeindewohnung ist für viele Menschen vor allem beschwerlich. Um einen Anspruch auf diese Wohnungen zu besitzen, muss man mindestens zwei Jahre einen stabilen Wohnsitz in Wien nachweisen können. Darüber hinaus werden langjährige Wiener_innen bei der Wohnungsvergabe systematisch bevorzugt. Auch die lange Warteliste macht es nicht gerade leicht, eine Gemeindewohnung zu erhalten.
Außerdem sind die Kriterien der Wohnungsvergabe an das Idealbild der österreichischen Kleinfamilie angepasst. Einen Anspruch auf eine Gemeindewohnung gibt es zum Beispiel, wenn man einen “Überbelag” nachweisen kann, also wenn zu viele Menschen auf zu kleinem Raum leben. Dabei werden nur die Eltern, Großeltern und Kinder berücksichtigt. Wer mit anderen Verwandten oder als WG zusammenlebt, wird so benachteiligt.
Auf dem privaten Wohnungsmarkt ist die Situation noch viel angespannter. Wohnungen werden im Kapitalismus wie jede andere Ware behandelt, somit steht hier nicht das existenzielle Bedürfnis nach einem Zuhause im Vordergrund, sondern ein möglichst großer Gewinn durch hohe Mieten.
»Helena: Wie könnten wir das Miteinander in der Stadt besser gestalten? Gibt es positive Beispiele?
Raphael: Unser Ziel sollte sein, dass möglichst alle an der Stadtentwicklung teilhaben und selbst über ihren Lebensraum entscheiden können. Konkret gibt es sehr unterschiedliche Ansätze, die Stadt “von unten” zu gestalten.
Manche Städte haben zum Beispiel das Konzept der „Urban Citizenship” etabliert. Dabei soll allen Bewohner_innen, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus, die Teilhabe am städtischen Leben ermöglicht werden – entscheidend ist, dass sie in der jeweiligen Stadt leben. Das bedeutet etwa einen unbürokratischen und kostenlosen Zugang zu Krankenversorgung oder Bildungseinrichtungen.
Ein weiterer Schritt hin zu einer Stadt für alle ist die Idee der „Sanctuary Cities”. „Sanctuary Cities” sind in den USA entstanden, aber es gibt auch in Europa immer mehr “Zufluchtsstädte”. Diese Städte weigern sich etwa, mit Bundesbehörden bei der Abschiebung von Migrant_innen zusammenzuarbeiten und ihre Anordnungen umzusetzen.
Um solche Veränderungen überall durchzusetzen, braucht es soziale Bewegungen, die Mitbestimmung einfordern. Eine Stadt für alle wird es nur als Ergebnisse entschlossener politischer Kämpfe geben. Ich würde sagen, die zentrale Frage für die Zukunft lautet: Wer kann unter welchen Bedingungen mitentscheiden, wie die Gesellschaft und unser Zusammenleben aussehen soll?
»Emil: Danke für das spannende Gespräch!
Raphael Kiczka arbeitet seit drei Jahren in Wiener Gemeindebauten und beschäftigt sich vor allem mit der Konfliktbewältigung zwischen den Bewohner_innen. Im Rahmen seines Studiums setzte er sich mit städtischen Ressourcen und (institutionellen) Ausschlusspraktiken auseinander. An der Uni Wien organisierte er verschiedene Lehrveranstaltungen zum Thema Stadtpolitik und Recht auf Stadt.
Mehr:
Stadt für alle!
Eine Aufsatzsammlung herausgegeben von Heidrun Aigner und Sarah Kumnig.
Wem gehört die Stadt? Urban Commons als Wegbereiter einer Stadt für alle
Ein Artikel von Raphael Kiczka, online verfügbar.
Solidarische Städte in Europa. Urbane Politik zwischen Charity und Citizenship
Eine Broschüre der Rosa Luxemburg Stiftung, online verfügbar.