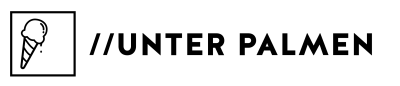Der Tod meines Großvaters gab mir die Gelegenheit, sexistische Dynamiken in meiner Familie zu reflektieren. Ein Plädoyer für eine umfassendere Erinnerungskultur.
– von Fricka Lindemann

Vor einem Jahr ist mein Großvater unerwartet verstorben. Nach der ersten Verarbeitung des Schocks begannen die Rituale um Körper, Geist, und Hinterbliebene(-s). Im Rahmen dieser Herausforderung webten sich Familienbande neu. Innerhalb der Generationen und über sie hinaus entstand mehr Empathie und größeres Verständnis füreinander, Gemeinsamkeiten wurden neu wahrgenommen.
Aufgrund meiner Lebensumstände konnte ich an all diesen Geschehnissen nur telefonisch teilnehmen. Ich fragte mich täglich, welche Verantwortung ich in dieser Situation zu tragen hatte. Entsprechend meiner Möglichkeiten über die Distanz hinweg wollte ich für die anderen da sein, doch welche Fragen und Themen angemessen waren, war mir unklar. Ich hatte kein Modell, an dem ich mein Verhalten orientieren konnte. Für mich war es schwer einzuschätzen, ob meine ambivalenten Gefühle über den Verlust meines Großvaters für die anderen nachvollziehbar und meine Fragen dementsprechend einfühlsam oder gar angemessen waren.
FAMILIENGESCHICHTE(N)
Meine Großeltern trennten sich, als ihr letztes Kind in der Pubertät war. Während meine Großmutter für mich auch deswegen immer eine emanzipierte, selbstbestimmte Frau verkörperte, sah ich in meinem Großvater immer wieder das Fortbestehen des Patriarchats repräsentiert. Dieses Gefühl stammte zum einen aus den Dynamiken seiner späteren Beziehungen: Er entschied, was bei Familienzusammenkünften passierte; wann gegessen wurde, wer wo saß, wann man ruhig zu sein hatte, wann wir etwas gemeinsam unternahmen oder wer bei Festen willkommen war.
»Entsprechend meiner Möglichkeiten über die Distanz hinweg wollte ich für die anderen da sein, doch welche Fragen angemessen waren, und vor allem welche Themen, war mir unklar.«
Zum anderen rührte dieses Gefühl von mangelnder Aufmerksamkeit und Wertschätzung in Bezug auf meine Leistungen und Träume her. Erst spät stellte ich fest, dass sein Umgang mit diesen sensiblen Themen Heranwachsender geschlechtsspezifisch war. Das machte sich zum Beispiel in der Art und Weise bemerkbar, wie er meine Erfolgschancen für die Zukunft bewertete.
»Die stille gesellschaftliche Präsenz sexistischer Dynamiken mischte sich mit dem Tabu, negativ über Tote zu reden.«
So zeigte er mir Alternativen auf, die nichts mit meinen Interessen zu tun hatten, aber von ihm als „sichere Option“ beschrieben wurden, oder vergaß mein eigentliches Interessensgebiet – trotz seiner ausgezeichneten kognitiven Fähigkeiten – bei jeder Begegnung wieder. Ich stellte fest, dass er die Ziele und Aussichten meiner cis-männlichen Cousins anders bewertete als die von mir als FLINTA-Person.
BEZIEHUNGEN ALS INDIVIDUELLES UND KOLLEKTIVES ERLEBNIS
Das mikroaggressive Verhalten meines Großvaters war schwer messbar und ähnlich schwer aufzeigbar. Erst am Ende unserer gemeinsamen Zeit habe ich seine unterschwelligen Annahmen verstärkt wahrgenommen und angefangen, mit ihnen umgehen zu lernen. Nach seinem Tod arbeitete meine Familie den Verlust auf – jede_r für sich, alle gemeinsam, doch fast komplett ohne mich. In Gesprächen mit Freund_innen gelang es mir, meine Wahrnehmung über die Rolle meines Großvaters zu äußern. Da die Menschen, mit denen ich sprach, den Verlust nicht selbst verarbeiten mussten, fiel es mir leichter, dort anzusetzen, wo sein Leben mit meinem verwoben war. Mit meiner Familie hingegen nahm ich eine ähnliche Auseinandersetzung als nicht möglich wahr – obwohl sie sicherlich auch für andere Familienmitglieder hätte hilfreich sein können. Die stille gesellschaftliche Präsenz sexistischer Dynamiken mischte sich mit dem Tabu, schlecht über Tote zu reden.
PATRIARCHALE DYNAMIKEN IM WANDEL DER ZEIT
Doch was spricht dagegen, schlechte Eigenschaften Verstorbener zu benennen? Im Rahmen meiner Auseinandersetzung mit dieser Frage stoße ich auf eine Pfarrerin, die Fairness als Grund aufführt: Tote können ihre Version der Geschichte nicht mehr erzählen. Und ich habe meinen Großvater tatsächlich selten mit seinen Annahmen konfrontiert. Auch ich könnte eine andere Version meiner Geschichte über ihn ehrlich teilen, aus der ersichtlich wird, dass er auch eine positive Rolle in den Leben vieler Menschen gespielt hat – die gängige Art des Gedenkens.
»Feminismus heißt, limitierende Annahmen und abträgliche Dynamiken aufzudecken, die auch mein Großvater in sein soziales Gefüge gespeist haben.«
Tatsächlich wird das Verhalten meines Großvaters weder durch den Austausch mit Angehörigen noch durch diesen Artikel ungeschehen gemacht. Allerdings lebt sein Erbe in mir weiter und in allen, mit denen er in seinem Leben im Austausch stand. Mein Großvater war sicherlich auch Teil einer Generation, in der ein anderes Verständnis von Geschlechtergerechtigkeit vorherrschend war als das, für das ich und meine Genoss_innen kämpfen. Wir versuchen Antworten auf Fragen zu finden, die sich meinem Großvater nie gestellt haben – denn Feminismus heißt, limitierende Annahmen und abträgliche Dynamiken aufzudecken, die auch mein Großvater in sein soziales Gefüge gespeist haben. Wenn wir uns in der Trauer gemeinsam dieser Fragen annehmen, ebnen wir den Weg für eine reflexive, empathische Gemeinschaftskultur, in der wir erinnern, anstatt zu verkennen.
Zum Weiterlesen:
endlich. Über Trauer reden (2022) – Susann Brückner und Caroline Kraft bieten in ihrem Buch und Podcast Anhaltspunkte zur feministischen Gestaltung des Trauerprozesses.
Speak Out! (2020) – Soraya Chemaly zeigt in ihrem Buch, warum Wut auf Verwandte wichtig ist, um freiere Familienverhältnisse zu entwickeln.