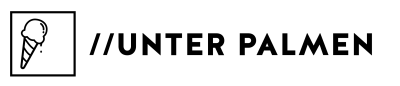Uns geht es ums Ganze. Doch was soll das überhaupt sein? Und wie kommen wir dazu? Das Verhältnis zwischen Utopie und Praxis ist ein verzwicktes Problem. Diesem wollen wir uns stellen.
– by Anna Biberkopf und Rainer Müller
„Die harte Einsicht, dass die Utopie ziemlich weit weg vom Hier und Jetzt ist, muss man erstmal verdauen.“
Die Vorstellung einer Gesellschaft, in der alle frei von Existenzangst leben können, klingt ziemlich verlockend. Aber stell dir vor, du wirst heute eingeladen, der ganzen Welt deinen Plan zur Erreichung dieses Ziels vorzustellen. Angesichts des weltweiten Leids wirkt jede politische Handlung erstmal relativ sinnlos. Wo soll man da anfangen? Abschiebungen verhindern, eine kritische Zeitung publizieren, der Gewerkschaft beitreten? Die Frage: „Was tun?“ scheint unlösbar. Gerade die aktuelle Situation in Österreich zeigt, dass politische Arbeit zuerst einmal heißt, gegen einen Abbau bereits erreichter Errungenschaften anzukämpfen. Sich auszumalen, dass alles ganz anders sein könnte, spendet dabei eher nur Trost. Die harte Einsicht, dass die Utopie ziemlich weit weg vom Hier und Jetzt ist, muss man erstmal verdauen.
Denn sie wissen nicht, was sie tun
Die Suche nach einem Weg heraus aus der politischen Ohnmacht lässt uns nicht los. Ohne eigenes Zutun wird die Utopie jedenfalls nicht verwirklicht werden. Vielmehr ist der Weg zur Utopie ein Aushandlungsprozess innerhalb der Gesellschaft, weshalb er nicht durch autoritäre Mittel erzwungen werden kann. Unser Ansatz ist deshalb, sich gegenseitig politisch zu bilden, indem Probleme in unserer Gesellschaft aufgezeigt und kritisiert werden. Das heißt: den Finger in die Wunde legen. Gleichzeitig versuchen wir, uns mit Menschen zu solidarisieren und ihnen Aufmerksamkeit zu schenken, wenn sie Hilfe benötigen. Egal ob man einen Lesekreis organisiert, demonstriert, Leerstand für sich beansprucht, die Lohnarbeit verweigert oder sich sozial engagiert – das Ziel all dieser Handlungen ist es, die Situation der Menschen zu verbessern. Gerade, weil diese Tätigkeiten sehr unterschiedliche Risiken für die Beteiligten bergen, gilt es, verschiedene Bedürfnisse und Möglichkeiten zu respektieren.
„Unser Ansatz ist deshalb, sich gegenseitig politisch zu bilden, indem Probleme in unserer Gesellschaft aufgezeigt und kritisiert werden.“
Aber in was für einem Verhältnis steht diese politische Arbeit zur konkreten Errichtung einer besseren Gesellschaft? Hilft es uns, vereinzelt an der Oberfläche des Kapitalismus zu kratzen? Wenn wir Veränderung wollen, reicht es dann nicht, zu warten, bis alles den Bach runtergeht? Denn müssten die Menschen dann nicht merken, dass es Zeit ist, aufzubegehren?
Was ihn nicht umbringt, macht ihn nur stärker?

Höhere Löhne, staatlich finanzierte Kindergartenplätze und mehr Schlafplätze für wohnungslose Menschen sind keine umwälzenden Forderungen. Der Kapitalismus ist eine flexible und zähe Angelegenheit: Er schafft es, soziale Forderungen zu integrieren. Die Arbeiterin, die jetzt mehr Lohn bekommt, wird sich damit vielleicht ein Auto kaufen. Die Mutter, die ihr Kind in den Kindergarten schicken kann, nutzt womöglich die freie Zeit für eine Ausbildung und wird dadurch zu einer besser qualifizierten Arbeitskraft. Und wer glaubt, dass alle wohnungslosen Menschen in Notschlafstellen rumhängen und nicht arbeiten würden, irrt gewaltig.
„Wer sich nicht mehr jeden Tag fragen muss, wie nächsten Monat die Miete oder die Ausbildung der Kinder finanziert werden soll, hat Zeit und Kraft, sich mit anderen Dingen als dem unmittelbaren Existenzkampf zu beschäftigen.“
Dass soziale Forderungen dem Kapitalismus nicht unbedingt schaden, sondern ihn sogar besser laufen lassen, ist ein Widerspruch, der sich nicht auflösen lässt. Dennoch unterstützen wir politische Kämpfe, die eine Besserstellung der Lebenssituation von uns allen im Hier und Jetzt ermöglichen. Denn zum einen gilt: Wer sich nicht mehr jeden Tag fragen muss, wie nächsten Monat die Miete oder die Ausbildung der Kinder finanziert werden soll, hat Zeit und Kraft, sich mit anderen Dingen als dem unmittelbaren Existenzkampf zu beschäftigen. Einer verbreiteten Vorstellung, dass erst das absolute Elend die Menschen wachrütteln und zum politischen Kampf antreiben würde, widersprechen wir. Aus der Not entsteht nicht automatisch etwas Besseres. Häufig führt sie zu Ohnmacht und Resignation oder blinde Wut, die sich gegen „die da oben“ oder gegen noch schlechter Dastehende richtet.
„Unsere Forderung nach einer ganz anderen Gesellschaft, in der der vorhandene Reichtum allen zugute kommt, geben wir dabei nicht auf.“
Zum anderen können wir aus einem gemeinsamen Kampf um konkrete Verbesserungen in unserem Leben Stärke gewinnen. Anstatt uns als vereinzelte Konkurrent_innen zu begegnen, würden wir dann solidarisches Handeln erlernen. Das bedeutet, dass man nicht auf seinen bloßen Nutzen für andere reduziert wird. Unsere Forderung nach einer ganz anderen Gesellschaft, in der der vorhandene Reichtum allen zugute kommt, geben wir dabei nicht auf. Auch wenn sich ein großer Spalt zwischen unseren Kämpfen und unserer Utopie auftut, der uns wie ein großer, lähmender Abgrund erscheint, müssen wir diesen ins Auge fassen, immer wieder abwägen und letztlich überkommen. Denn die Ohnmacht, die den Widerspruch zwischen Praxis und Utopie begleitet, darf uns nicht im Weg stehen.
Mehr:
„Was tun? Was lesen!“
Ein Artikel der Straßen aus Zucker.
Phase 2 #33
Eine Zeitschriftzum Thema „Bis zur Revolution“.
„Erfinde eine bessere Welt“
Ein Beitrag von Streetphilosophy, produziert von ARTE.